Nadja aus Mariupol am Donnerstag, den 24.2.2022, sie weint am Telefon und sagt:
„es ist schrecklich, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir fassen nicht, was gerade
passiert. Mein Bruder Schenja bringt Lebensmittel zu den Omis. Wir passen
aufeinander auf und sorgen uns umeinander.“
So begann mein Chatverlauf am vergangenen Donnerstag mit Nadja. Sie ist die
älteste Tochter der Familie Kaschkawal aus Mariupol in der Ukraine. Bei dieser Familie
habe ich 1999 fünf Monate gewohnt und dort in der Stadt mein Praktikum in Sozialer
Arbeit gemacht. Eine spannende und herausfordernde Zeit. Fassungslos erlebe ich mit,
wie sich die Freunde plötzlich „über Nacht“ in Lebensgefahr befinden. Die
Kaschkawals, alle im Alter von 36 – 41, haben Familie, das jüngste Kind, ein Mädchen
wurde Anfang Dezember 2021 geboren.
Am Donnerstag treffen sie sich bei den Eltern im Haus, der Vater Stephan Kaschkawal
ist Notarzt im Ruhestand, die Mutter Olga, jetzt Rentnerin hat Hautkrebs. Es sind 11
Erwachsene und 8 Kinder, sie reden, ordnen sich, überlegen, wie es weitergehen kann.
Jeden Morgen frage ich, wie es ihnen geht, hoffe auf Nachrichten. Manchmal dauert es
lange, bis eine Reaktion kommt, der Strom ist abgeschaltet, die Handyzeit kostbar.
Die Antworten meiner Freunde beginnen mit „Gott sei Dank, wir leben!“ Es sind kurze
Sätze, ich weine vor Erleichterung, atme auf.
Als der Beschuss auf Mariupol zunimmt, frage ich, ob sie in einen Keller oder Bunker
gehen können. Schenja antwortet, es gibt nur einen kleinen, feuchten Keller, dort
haben nicht alle Platz. Ich erinnere mich an den Keller, es ist ein Loch, in dem die
Kaschkawals ihre Kartoffeln über den Winter lagern, anderthalb Meter im Quadrat. Am
Sonntag lautet Schenjas Nachricht: „Hallo Conny, Gott sei Dank leben wir, es gibt
keinen Strom, Internet nur selten, wir beten.“
Montagmorgen: „Gott sei Dank, die Nacht war ruhig.“ Am Montagmittag um 12.23 Uhr
schreibt Schenja, dass er mit seiner Familie, seinen Geschwistern und deren Kindern
auf der Flucht ist. Sie versuchen, aus Mariupol herauszukommen, wir sollen für sie
beten. Ein Vorort im Osten Mariupols namens Sartana wurde beschossen sowie
Wolnowacha, eine Stadt unmittelbar nördlich. Es ist schrecklich, unwirklich,
grauenvoll.
Seit Donnerstag schreibe ich E-Mails an meine Gemeinde, rede mit Freunden, wir
beten, protestieren gegen den Krieg in der Ukraine, sammeln Hilfsgüter, alle sind
geschockt. Am Montag schickt Nadja von unterwegs eine Sprachnachricht, sie sagt mit
großem Schmerz, ihre Eltern sowie ihr Bruder Sascha sind in Mariupol geblieben.
Nadja hat große Angst um sie.
Abends die Information, meine Freunde haben Saparoschschja erreicht und
übernachten dort. Dienstag, 1.3.2022, sie sind ein großes Stück weitergekommen,
fahren gerade aus Kryvyi Rih heraus. In Nadjas Nachricht höre ich die Furcht vor dem,
was sie an der Grenze zu Moldawien erwartet. Lange Wartezeit, viele Autos, Kälte. Sie
sind erschöpft.
Die bange Frage, werden die Männer an der Grenze zurückgehalten? Vermutlich. Und
dennoch, wir beten und hoffen auf Wunder und Hilfe! Zuhause die Überlegung, was
wir vorbereiten können. Meine Cousine telefoniert mit den zuständigen Behörden,
plant Unterkünfte und Versorgung. Dienstagabend, Nadja und ihre Familie haben es
nach Moldawien geschafft! Gott sei Dank! Ihre Brüder Schenja und Andre stehen noch
ca. 200 Kilometer vor der ukrainischen Grenze. Schenja darf nicht rüber, weil die
Familie nur 2 Kinder hat und nicht drei, so der Stand Dienstagabend. Wir hoffen, dass
die Kaschkawals alle die Grenze passieren dürfen und sich ausruhen können. Weiter
beten wir, dass ihre Eltern und ihr Bruder Sascha in Mariupol am Leben bleiben.
Conny
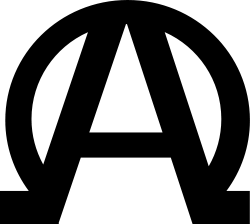 Jesus Freaks Chemnitz
Jesus Freaks Chemnitz